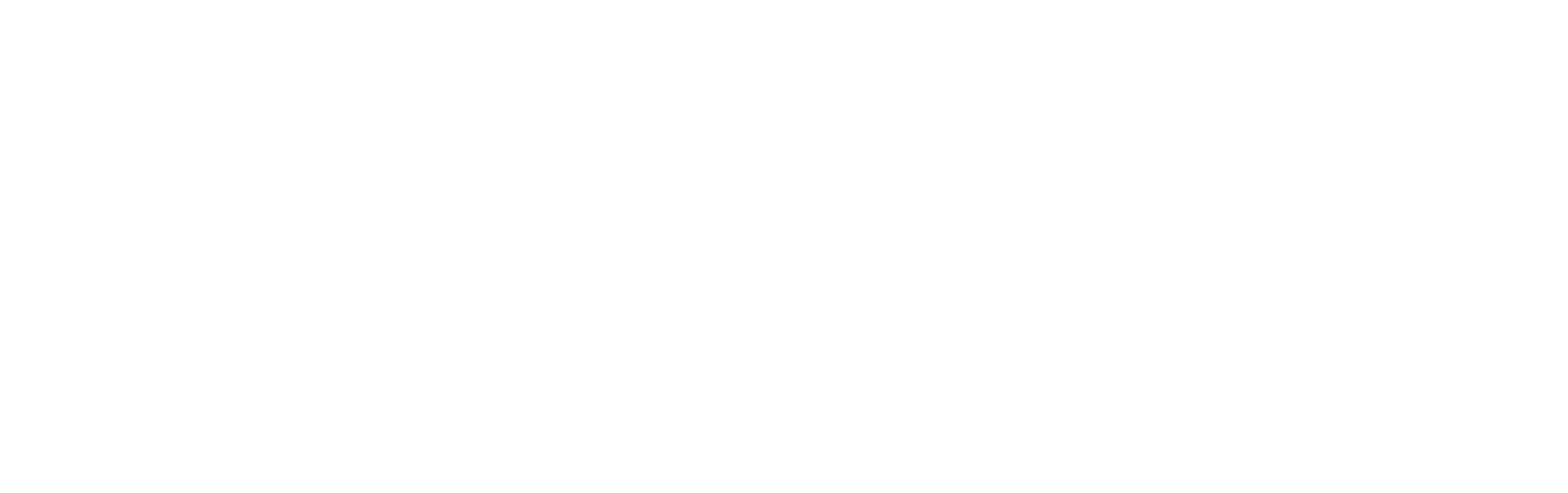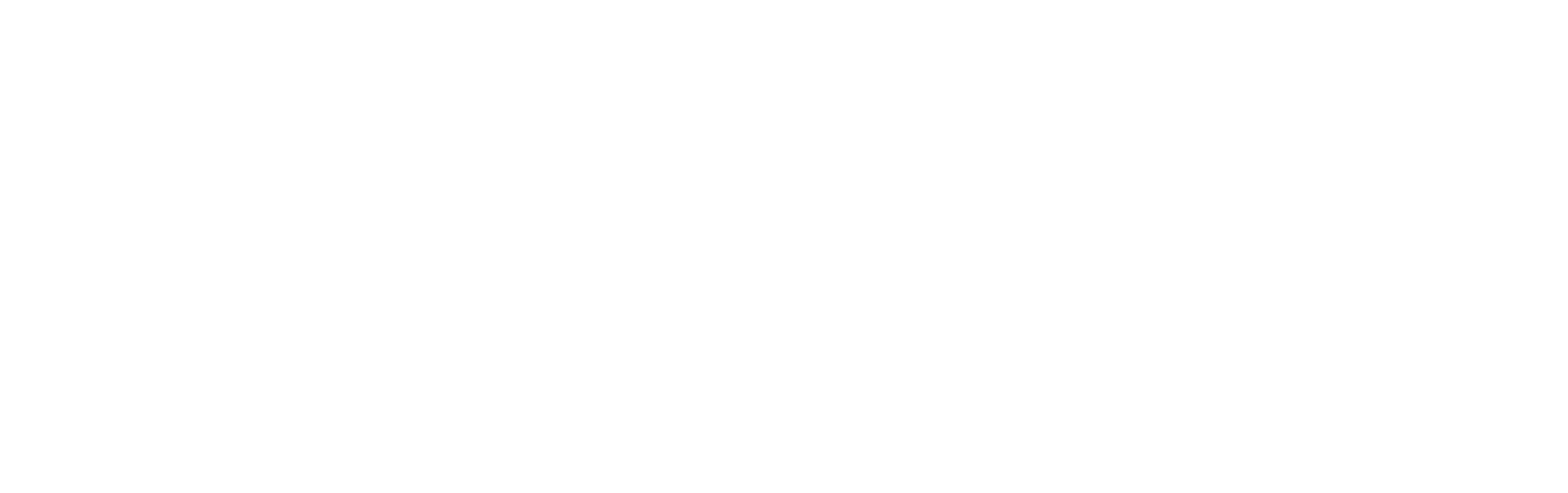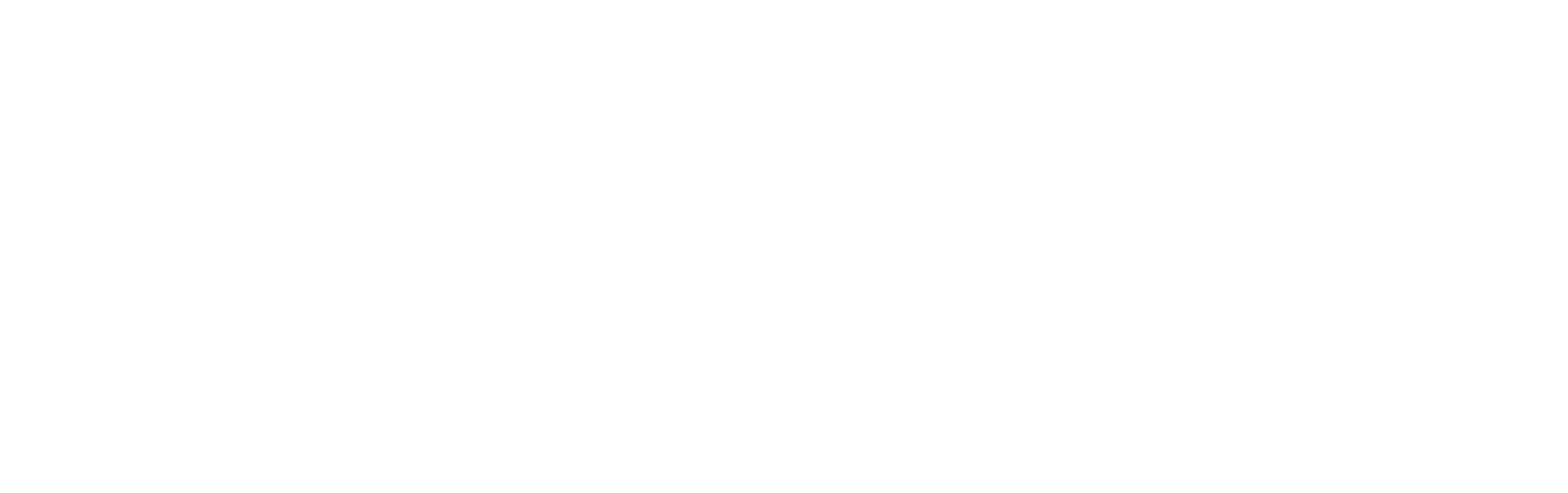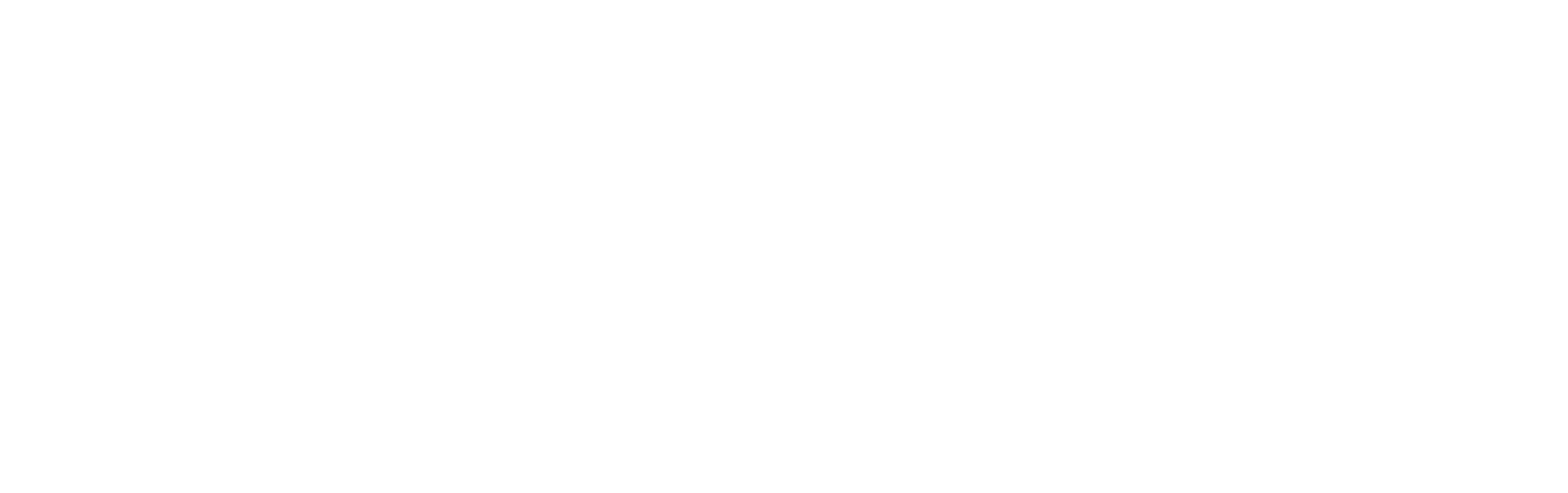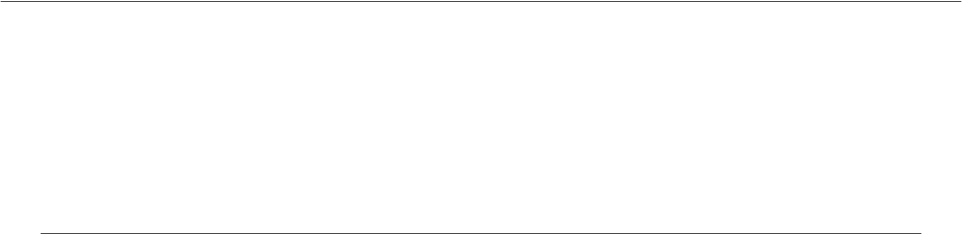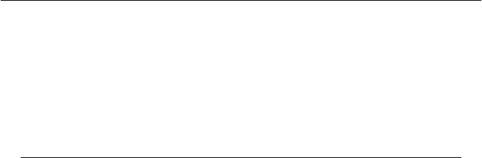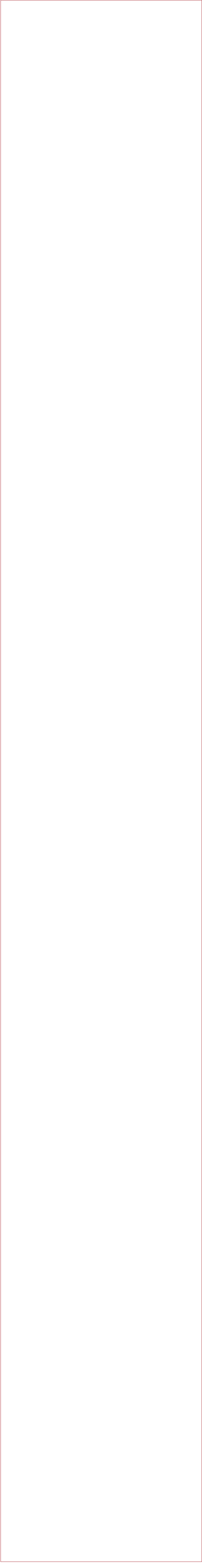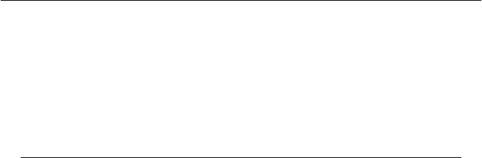

Grundlagen
Was versteht man
unter TCM?
Die
Traditionelle
Chinesische
Medizin
(TCM)
hatte
ihren
Ursprung
vor
mehr
als
2000
Jahren
in
China.
Anders
als
die
westliche
Medizin,
die
zumeist
analytisch
nach
einer
exakten
Diagnose
sucht
und
jede
dieser
Diagnosen
einzeln
behandelt,
arbeitet
die
TCM
ganzheitlich.
Hierbei
ist
die
Ernährung
die
größte
und
wichtigste
Säule,
erst
danach
folgen
Akupunktur,
Akupressur,
Kräuter,
Massagen
und
Bewegungslehre.
Anders,
als
in
der
westlichen
Medizin,
sind
Körper,
Geist
und
Seele
eine
Einheit
und
werden
auch
so
behandelt.
Ein
chinesischer
Arzt
geht
daher
komplett
anders
vor,
als
ein
westlicher
Mediziner:
Er
untersucht
bestimmte
Akupunkturpunkte
auf
den
sogenannten
Leitbahnen
(Meridianen)
auf
Druckschmerz
und
behandelt
diese,
je
nach
Fall
mit
Akupunktur,
Akupressur
oder
auch
Wärme
(Moxatherapie).
Über
Zungen
-
und
Pulskontrolle
wird
das
chinesische
Diharmoniemuster
verfeinert.
Eine
Zunge
kann
sich
im
Laufe
der
Zeit
komplett
verändern,
das
ist
auch
für die Klienten sehr spannend zu sehen.
Die
Meridiane
oder
Leitbahnen
sind
größenteils
den
chinesischen
Organen
zugeordnet
und
ziehen
über
den
gesamten
Körper.
Auf
ihnen
befinden
sich
Punkte,
die
bei
bestimmten
Problemen
schmerzhaft
sind.
Sehr
häufig
liegen
-
mitunter
jahrelange
-
Auffälligkeiten
oder
Schmerzen
im
Bereich
von
Akupunkturpunkten
oder
ziehen
regelrecht
an
Meridianverläufen entlang, z. B. Hautprobleme.
Was hat es mit Kälte,
Hitze, Feuchtigkeit,
Trockenheit und Wind
auf sich?
Die
TCM
betrachtet
äußere
pathogene
(krankmachende)
Faktoren,
wie
Kälte,
(Sommer-)
Hitze,
Feuchtigkeit,
Trockenheit
und
Wind,
die
in
die
Leitbahnen
eindringen
und
bestehende
Probleme
verschlechtern
können.
Typische
Beispiele
sind
Arthroseschmerzen
oder
Blasenentzündungen
bei
nasskaltem
Wetter
oder
Herzprobleme
bei
Hitze.
Hier
setzt
die
TCM-
Ernährung
an,
denn
es
gibt
energetisch
trocknende,
befeuchtende,
kühlende
und
wärmende
Nahrungsmittel.
Im
Gegensatz
zur
Schulmedizin
wird
bei
der
Traditionellen
Chinesischen
Medizin
der
gesamte
Körper
ganzheitlich
betrachtet
und
sie
bezieht
auch
Geist
und
Seele
mit
ein.
Emotionen
können
daher
bestimmte
Disharmonien
triggern
oder
umgekehrt
werden
durch
bestimmte
Beschwerden
gewisse
Emotionen
ausgelöst,
z.
B.
entsteht
Jähzorn
oder
ein
cholerisches
Temperament
durch
Disharmoniemuster
in
der
Leber.
Ängstlichkeit
wird
den
Nieren
zugeordet,
Sorgen
und
Trauer
der
Lunge.
Mehr
dazu
bei
den
5
Elementen
.
Was hat die Leber mit
den Augen zu tun?
Weiterhin
ist
es
in
der
TCM
so,
dass
sich
innere
Organe
bei
Störungen
nach
außen
hin
öffnen
und
so
Probleme
aus
dem
inneren
des
Körpers
nach
außen
hin
sichtbar
werden.
Zum
Beispiel
öffnet
sich
die
Leber
in
die
Augen
oder
die
Nieren
in
die
Ohren.
Das
bedeutet
sehr
vereinfacht
gesagt,
dass
bei
Leber-
oder
Nieren-Disharmonien
mit
der
Zeit
auch
die
Augen
oder
Ohren
Störungen
zeigen.
Daher
ist
ein
gesundes
Gleichgewicht
der
5
Elemente
so
wichtig.
Ausführlicheres
zu
diesem
Thema
finden
Sie
unter
5
Elemente
.
Wichtig
zu
wissen:
Etwaige
Auffälligkeiten
an
den
Organen
nach
TCM
sind
nicht
(!)
gleichzusetzen
mit
schulmedizinischen
Diagnosen
oder
Blutbildern!
Zeigt
die
chinesische
Niere
oder
Leber
ein
Disharmoniemuster,
bedeutet
das
nicht,
dass
Sie
zwangsläufig
einen
Leber-
oder
Nierenschaden
haben
oder
bekommen,
da
die
chinesischen
Organe
nicht
eins
zu
eins
auf
die
westlichen
Organe
übertragbar
sind.
Manchmal
ist
hier
auch
schulmedizinisch
noch
keine
Auffälligkeit
zu
sehen,
während
die
TCM
bereits
eine
Stagnation
erkennt,
was
auf
jeden
Fall
positiv
zu
bewerten
ist,
denn
so
kann man schon früh präventiv tätig werden.
![]()
![]()
![]()


Verdauung nach TCM:
Im
Bauch
befindet
sich
aus
Sicht
der
TCM
ein
Kochtopf
mit
kochender
Suppe.
Der
Magen
verwandelt
die
zugeführte
Nahrung
in
diese
heiße
Suppe.
Isst
man
kalte
Nahrung,
muß
er
sie
erst
erwärmen,
ist
sie
trocken,
muß
er
Feuchtigkeit
zuführen.
Der
aufsteigende
Dampf
ist
das
aus
der
Nahrung
gewonnene
Qi
(Lebensenergie).
Ohne
Dampf
also
kein
Qi!
Der
Körper
kann
dann
die
Nährstoffe
nicht
aufnehmen
und
Mängel
entstehen.
Durch
zu
viel
Kaltes
kühlt
die
Suppe
ab
und
kann
gar
nicht
mehr
dampfen.
Nun
beginnt
der
Kreislauf:
Kalte
Suppe
steht
im
Bauch
und
entwickelt
sich
zur
pathogenen
(krankmachenden)
„Feuchtigkeit“,
da
sie
nicht
verdampfen
kann.
Diese
wird
z.
B.
eingelagert
in
Form
von
Ödemen,
Bauchfett,
Schleim
in
der
Lunge
oder
sie
zeigt
sich
auf
der
Haut
als
Akne.
Alte,
eingelagerte
Reste
können
auch
wieder
verdampfen
mit
der
Zeit,
wenn
die
Nahrung
optimiert
und
die
Disharmonie
beseitigt wird.
Problem von Feuchtigkeit und Schleim:
twas
Feuchtigkeit
im
Körper
ist
normal.
Ein
Zuviel
allerdings
erstickt
das
Qi.
Feuchtigkeit
ist
daher
zumeist
an
schweren
Erkrankungen
beteiligt.
Durch
Hitze
und
Stagnation
dickt
sie
ein
zu
Schleim
(TCM:
Feuchte
Hitze),
welcher
deutlich
schwerer
auszuleiten
ist
als
Feuchtigkeit.
Schleim
und
Feuchtigkeit
sind
z.
B.
erkennbar
als
Lipom
oder
Auswurf
beim
Husten,
aber
auch
als
Arterienverkalkung
oder
Bluthochdruck,
an
einer
ständig
laufenden
Nase,
Ödemen,
Übergewicht,
Gelenkschmerzen
oder
viel
Augen-
und
Ohrenausfluß.
Die
Milz
hat
in
der
TCM
eine
besondere
Bedeutung:
Die
Milz
ist
der
Ursprung
für
Qi
und
Blut
(Xue)
und
steht
daher
im
Mittelpunkt
der
Verdauung,
zusammen
mit
dem
Magen
und
dem
Pankreas.
Dabei
ist
die
„chinesische
Milz“
nicht
eins
zu
eins
anatomisch
und
medizinisch
übertragbar
auf
die
„westliche
Milz“.
Dies
gilt
ebenso
für
alle
anderen
Organe
und
das
Blut.
Milz,
Pankreas
und
Magen
sind
nach
TCM
Partner
und
zuständig
für
die
Verdauung
und
daher
die
Basis
der
Gesundheit.
Bei
Ungleichgewichten
kommt
ein
Milz-Qi-Mangel
am
häufigsten
vor.
Symptome
des
Qi-Mangels
sind
z.
B.
Verdauungsprobleme,
weicher
Kot,
Blähungen,
Neigung
zu
Allergien
und
Unverträglichkeiten,
Müdigkeit,
Appetitlosigkeit,
Magenschmerzen,
Aufstoßen,
Zahnfleischblutungen,
schwache
Muskeln, ...
Die thermische Wirkung von
Nahrungsmitteln:
Dabei
geht
es
nicht
um
die
Temperatur
des
Essens,
sondern
um
die
energetische
Eigenschaft.
Auch
heiße
Getränke,
wie
z.
B.
Salbeitee,
können
kühlend
wirken.
Diese
thermische
Wirkung
kann
man
in
der
TCM
gezielt
nutzen,
um
z.
B.
Hitze-Zustände
mit
kühlenden
oder
Kälte-Zustände
mit
wärmenden Lebensmitteln zu beruhigen.
Durch
Kochen
und
Verarbeiten
ändert
sich
die
thermische
Wirkung
der
Nahrungsmittel.
Durch
das
Kochen
werden
viele
Nahrungsmittel
allerdings
auch
bekömmlicher,
denn
der
Magen
liebt
es
nach
TCM
warm,
saftig
und
regelmäßig.
Zudem
sollte
nicht
dauerhaft
über
Wochen
oder
Monate
nur
stark
Erhitzendes
oder
Kaltmachendes
verzehrt
werden,
da
diese
Einseitigkeit
ebenfalls
Disharmonien
auslösen
kann
und
Probleme
dann
plötzlich
in
die
andere Richtung kippen können.
Die thermische Wirkung von
Nahrungsmitteln kann beeinflusst
werden:
„Yinisieren“ = kühler machen durch:
in Wasser einlegen oder keimen lassen
kühlender bis kalt machen durch:
Nahrungsmittel in Kühlschrank oder
Tiefkühltruhe aufbewahren
Yangisieren = wärmer machen durch:
blanchieren, dünsten, garen, kochen,
schmoren.
Eine
Speise
gilt
auch
dann
noch
als
gekocht,
wenn
sie
nach
dem
Kochen
steht
und
abgekühlt
ist.
Ausnahme:
Aufbewahrung
im
Kühlschrank/Tiefkühltruhe,
dann
ist
die
Thermik kühler.
wärmender bis erhitzend machen durch:
braten, grillen, rösten oder Scharfes, wie
Ingwer, dazugeben.
Durch mehrere Verarbeitungsprozesse wird
ein Nahrungsmittel ebenfalls „heiß“. Daher
sind auch stark verarbeitete Lebensmittel
ungünstig bei Hitze-Symptomen.
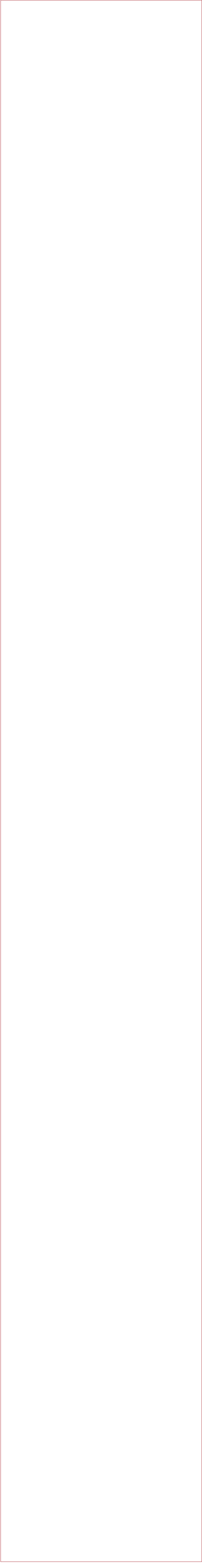
Die wichtigsten Begriffe der TCM kurz
erklärt
Was ist Qi?
Qi
ist
die
„Lebensenergie“
und
Grundlage
allen
Lebens
und
aller
Substanzen
im
Körper.
Dazu
gehören
z.
B.
Blut,
Körpersäfte
und
Yin
und
Yang.
Qi
schützt
vor
Krankheit,
nährt
Organe
und
Körper.
Zur
Stärkung
des
Qi
brauchen
wir
unter
anderem
qi-reiches
Essen
und
eine
gute
Verdauung,
um
es
aufnehmen
zu
können.
Natürliche
und
frisch
gekochte
Speisen
beinhalten
mehr
Qi
als
nur
aufgetaute,
ebenso
Nahrungsmittel
guter
Qualität
(Bio,
ohne
Pestizide
etc).
Zuckerhaltiges
oder
minderwertige
Qualität
raubt sogar Qi.
Das
Blut
(chin.
Xue)
nährt,
befeuchtet
und
kühlt den Körper:
Die
Blutbildung
erfolgt
aus
chinesischer
Sicht
durch
das
Qi,
welches
mit
Hilfe
der
Milz
aus
der
Nahrung
gewonnen
wird.
Daher
besteht
häufig
zusätzlich
ein
Blut-Mangel,
wenn
der
Körper
einen
Qi-Mangel
aufweist.
Das
Blut
nährt
und
befeuchtet,
kühlt
und
beruhigt
die
Nerven
und
sorgt
somit
auch
für
einen
erholsamen
Schlaf.
Bei
Blutmangel
drohen
Erschöpfung,
Nervosität,
Unruhe,
blasse
Schleimhäute,
trockene
Augen
und
Haut,
brüchige
Fingernägel
und
Haare,
Haarausfall,
trockener
Kot,
Anämie,
Eisenmangel,
Schreckhaftigkeit
und
Ängstlichkeit,
Schlafstörungen.
Auch
die
sogenannten
Körpersäfte
haben
eine besondere Bedeutung:
Sie
bestehen
aus
Speichel,
Schweiß
und
den
Verdauungssäften.
Diese
befeuchten
die
Sinnesorgane,
schmieren
Gelenke
und
halten
die
Haut
von
innen
geschmeidig.
Bei
einem
Mangel
entsteht
Trockenheit:
Trockene
Haut,
Schleimhaut,
Haare,
Augen,
sowie
trockener,
harter Kot.
Was hat es mit Yin & Yang auf sich?
Yin bedeutet ursprünglich „die schattige Seite
eines Hügels“ und steht für:
•
den gemütlichen Konstitutionstyp
•
Einlagern von Gewicht und Gegenständen:
„das kann ich noch gebrauchen“
•
nimmt schwer wieder ab, Diäten helfen
nur mäßig
•
friert schnell (sucht daher die Wärme)
•
verträgt warmes Wetter und Trockenheit
häufig gut
•
introvertierte Persönlichkeit
•
eher passiv-abwartend
•
häufig kraftlos
Yang bedeutet ursprünglich „die sonnige
Seite des Hügels“ und steht für:
•
aktive bis hitzige Konstitutionstypen,
„immer auf Achse“
•
nimmt eher schlecht zu, evtl. sogar
Untergewicht
•
dabei ständiges Hungergefühl
•
Wärme-/Hitzegefühl (sucht daher kühle
Plätze)
•
verträgt kaltes, feuchtes Wetter häufig
gut
•
extrovertierte Persönlichkeit
•
eher draufgängerisch
•
hohe Körperkraft
Alle
Dinge
haben
einen
Yin
und
Yang-
Aspekt:
Der
Tag
lässt
sich
in
Yin
(die
Nacht)
und
Yang
(den
Tag)
einteilen,
ebenso
der
zu-
und
abnehmende
Mond,
Temperaturen
oder
auch
die
Jahreszeiten
können
in
inaktiv
/
Yin
(Herbst
und
Winter)
oder
aktiv
/
Yang
(Frühling
und
Sommer)
eingeteilt
werden.
Diese
Eigenschaften
bilden
Gegensätze,
doch
sie
existieren
nur
in
Relation
zueinander.
Das
eine
kann
ohne
das
andere
nicht
sein.
Auch
der
Körper
beinhaltet
Yin-
und
Yang-Aspekte,
die
sich
normalerweise
gegenseitig
im
Gleichgewicht
halten
sollen.
Entstehen
Krankheiten,
die
sich
durch
Kälte,
Schwäche,
Antriebslosigkeit
ausdrücken,
überwiegt
das
Yin.
Beschwerden,
die
sich
mit
Hitze,
Aktivität,
Schnelligkeit
äußern,
werden
dem
Yang
zugeordnet
und
auch
anders
therapiert
als
Yin-Disharmonien.